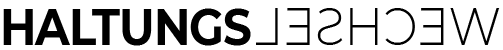Stab:Wechsel!
von Olav Schmidt
Kultur:Wechsel?
Ist man auf deutschen Landstraßen unterwegs, so kann es zu einem Wild:Wechsel kommen. Manchmal endet das einen Crash, bei dem meist das Wild unterlegen ist. Unter dem Thema Kultur:Wechsel geht es um interkulturelle und interreligiöse Begegnungen und darum wie eine Crash in Form von Rassismus und Diskriminierung (und ich füge hinzu Kolonialismus) vermieden werden kann. Nun, was ist eigentlich Rassismus?
Als Berliner Kind wurde ich in Bayern im Urlaub in der Skischule als „der Preiß“ bezeichnet. Der schwäbische Dialekt der Strandkorbnachbarn im Sommerurlaub löste bei unserer Familie Kommentare aus, die heute als „political uncorrect“ gelten würden. Ist das schon Rassismus? Im weiteren Sinne wahrscheinlich, denn es ging doch in beiden Fällen um ein Abstempeln einer ganzen Gruppe von Menschen. (Übrigens: Heute lebt meine Mutter in Bayern und ich bin mit einer Schwäbin verheiratet.)
Stereotypen können sowohl negativ wie positiv besetzt sein: Durch Wuppertal, wo wir jetzt wohnen, verläuft die Grenze zwischen Westfalen und dem Rheinland. Die Rheinländer sind Frohnaturen, die Westfalen Stoffel (sagt man). In Norddeutschland raucht man und trinkt Bier und Tee (selbst in der EmK in Elberfeld heißt es Kirchentee statt Kirchenkaffee!), im Süden trinkt man Wein und Kaffee.
Manchmal sind solche Verallgemeinerungen durchaus hilfreich: Emails an meine amerikanischen Freunde und Partner beginne ich mit einem Lob ihrer Arbeit. In Emails in Deutschland kommt man am besten gleich zur Sache. Nach (Sub-Sahara) Afrika versandt, wird erst einmal gefragt, wie es denn geht. Und ja: Das gilt für alle meine US-Kontakte von Florida bis Michigan und für alle Partner von West- bis Südostafrika!
Solche kategorischen Unterscheidungen sind in anderen Kulturen oft „überlebenswichtig“. In England (und Malawi) fragt man im Geschäft an der Kasse „How are you?“, „wie geht es?“ Als ich das in Deutschland tat, sagte der Blick der jungen Frau an der Kasse soviel wie „willst Du mich anbaggern, alter Mann?“
Natürlich sind Kulturen differenzierter. Aber zum Ankommen helfen solche einfachen Regeln, Modelle und Generalisierungen. Am Anfang sind Verallgemeinerungen hilfreich, aber je mehr man beobachtet, umso differenzierter werden die Erklärungen.
Die Problematik besteht nun darin, wenn man in der Phase nach dem „Honeymoon“, den „Flitterwochen“, in den Kulturschock rutscht. Das führt unter Umständen dazu, dass man auf die fremde Kultur herabblickt und die eigene überhöht. Leider ist das aber auch eine grundsätzliche Haltung, wenn man in Deutschland Menschen begegnet, die kulturell anders geprägt sind. Man ist gleichsam von der anderen Kultur schockiert.
Damit stellt sich nun aber die Gretchen-Frage: Warum reagiert man so? Gibt es vielleicht etwas in der eigenen Kultur, der eigenen Religion, womit man die fremde übertrifft? Haben wir den anderen etwas voraus? Kann man das so absolut sagen, oder ist das alles relativ, bzw. relational, also in der Begegnung zu klären?
Religions:Wechsel?
Ein Muslim erzählte mir, dass er am Ende seines Lebens vor einem großen Abgrund stehen würde. Über diesem wäre ein Seil gespannt, auf dem er auf die andere Seite balanciert, wo ihn Allah erwarten würde. Ein frommes Leben nach den Regeln des Koran wäre die Übung, um sicher auf die andere Seite zu kommen. (So bildlich ist es wohl nicht im Koran zu finden, war aber seiner Ansicht nach eine zutreffende Beschreibung.) Ich antwortete ihm, dass „mein“ Gott seinen Sohn über dieses Seil zu mir geschickt hätte und er mich eines Tages auf seine Schultern setzen und mit mir über das Seil zurücktanzen würde. (Steht so bildlich nicht in der Bibel, ist meiner Ansicht nach aber eine zutreffende Umschreibung von Errettung und Erlösung, wie sie mir die Bibel erklärt.) Habe ich ihm nun etwas voraus? Ich finde schon, denn das ewige Leben hängt für mich nicht von meiner eigenen Leistung ab.
Als Jugendlicher habe ich mich mit fast allen Religionen näher beschäftigt, und ich bin mir sicher, dass mich keine „in den Himmel gebracht hätte“ - weil es immer auf mich ankam. In unserer Nachbarschaft gab es ein „Buddhistisches Haus“, einen Lebensort für Mönche. In den Gesprächen dort entstand für mich der Eindruck, wirklich konsequent kann man den buddhistischen Weg zur Erlösung (also zur Befreiung von allem Leid durch persönliche Entsagung) nur als Mönch gehen. Und schon damals fragte ich mich, wie es wohl gelingen kann, die Welt zu einem friedlicheren Ort zu machen, wenn man sich aus dieser zurückzieht. Habe ich also diesen Menschen etwa voraus? Ich meine ja, denn als Christ lebe ich mitten in der Welt, zum Nutzen vieler.
Denn für mich als Christ erfahre ich Vergebung hier und heute. Ich weiß, dass ewiges Leben schon hier und heute beginnt. Dadurch gewinne ich Freiraum zum Handeln. Wer handelt, der macht Fehler. Wer Angst hat, es sich dadurch mit Gott zu verscherzen, ist arm dran. Wer meint, dass die Kirche mit einem Jenseitsversprechen Übel in der Gesellschaft einfach ignoriert, hat das Wesen des christlichen Glaubens nicht verstanden. Es ist unser Auftrag als Nachfolger Christi die Welt zu verändern, indem wir viele für diese Nachfolge gewinnen. Dabei sehe ich nicht auf den anderen herab - auch wenn ich überzeugt bin, dass ich den besseren, vielleicht den einfacheren Weg gewählt habe. Denn dieser hat sich mir nicht von selbst eröffnet (obwohl, eigentlich doch: Jesus Christus ist ja der Weg). Diesen Weg kenne ich aus Gnade, den kann ich als unverdientes Geschenk gehen.
Dabei ist es mir wichtig, die Ernsthaftigkeit der Menschen zu achten, die andere Wege gehen. Mein muslimischer Freund unternahm große Anstrengungen für seinen finalen Balanceakt. Manchmal wünschte ich mir diese Disziplin für mein eigenes Leben! Fünfmal am Tag beten, zu festen Zeiten, so dass es alle mitbekommen, das könnte dem Christen nicht schaden! Das Leben buddhistischer Mönche beindruckt mich zutiefst: Eine Regel lautet, nach 12 Uhr nicht mehr zu essen. Am liebsten würde ich um diese Zeit erst aufstehen! Ich begegne diesen Menschen mit Hochachtung und Respekt, und ich kann von ihnen lernen. Ich denke aber eben auch: Ich habe es besser. Und deshalb halte ich mit meinem Glauben auch nicht hinter dem Berg. Da kann ich nicht dieses oder jenes vom Evangelium wegkürzen, nur damit es keinen Crash gibt. (Es wurde allen Ernstes schon vorgeschlagen, die Kreuzigung Jesu im Dialog mit Muslimen auszublenden - ich frage mich, worüber soll man dann denn noch reden?) Ich werde mein Auto nicht über die Landstraße schieben, um einen Crash zu vermeiden (aber natürlich vorausschauend fahren).
Wechsel:Wirkung!
Der Glaube wird auch im Alltag des Glaubenden bestätigt. Gott in seiner Gnade rüstet den Menschen mit Gnadengaben, den Charismen, aus. Der Mensch erlebt, dass Gott durch ihn handelt und findet so Sinn und Frieden. Damit meine ich nun nicht so sehr Gaben wie Leitung oder Hirtendienst, die die Bibel beschreibt. Allzu leicht könnte man sie mit Charaktereigenschaften oder Gelerntem verwechseln, durch welche alle Menschen zu einem gelingenden Leben aller beitragen können.
Vielmehr wird der Glaube an den dreieinigen Gott wird von erhörten Gebeten, Zeichen und Wundern und auch Heilung begleitet - in einer Art und Weise, wie sie nach meinem Wissen nach in keiner anderen Religion erfahren wird. In traditionellen Religionen liegt die Kraft zur Krankenheilung in den Händen des Heilers. Seine Magie und sein „Draht“ zu den übernatürlichen Mächten sind ausschlaggebend und natürlich auch die Opfergaben der Kranken. Selbst im Islam, der natürlich keine Opfergaben der Menschen sucht und in dem Allah die höchste Autorität hat, soll nach meinen Recherchen der Koran mit einer Art magischer Kraft Heilung bewirken, wenn er richtig zitiert wird und Allah dem nicht widerspricht. Als Christ erfahre ich dagegen, dass Gott selbst heilt und Menschen gesund macht, wenn wir beten, aber auch hier ist Gott souverän in seinem Handeln. Wer ist hier nun im Vorteil? Der, der Heilen lernen kann, oder der, der sich alleine auf Gott angewiesen weiß? Ich merke: Ich weiß zu wenig über die Gabe der Heilung, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Und ich weiß viel zu wenig darüber, wie Heilung im Islam verstanden wird. Begegnung und Gespräch ist nötig.
Ekstatisches Stammeln kennt man aus traditionellen Religionen, Yoga praktiziert das Rezitieren von magischen Worten. Die Sprachenrede, die manchen Christen durch den Heiligen Geist geschenkt ist, ist Reden in der Vollmacht Gottes - sei es zur persönlichen Erbauung oder als zu übersetzende Worte für die Umstehenden. Prophetisches Reden, das Mitteilen von Eindrücken, seien es Bibelworte oder Bilder, ist keine Wahrsagerei. Wunder hat wohl schon jeder Christ irgendwann in seinem Leben erfahren. Aber es fällt schwer, darüber zu reden. Man fürchtet als Spinner abgetan zu werden oder dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, man würde dem Zufall den Namen „Gott“ geben.
In Malawi habe ich viele Wunder erlebt: Von Regen, der punktgenau zur Predigt-Illustration einsetzt, bis zur defekten Ölpumpe, die Hunderte von Kilometer weiter funktioniert. Gott ist ein wunderbarer Herr und so folgen Wunder auf Gebete. Ich habe beschlossen, in Deutschland so zu beten wie in Malawi. Neulich sollten meine beiden Kinder mit der Bahn fahren. Wir haben dafür gebetet, dass die Züge pünktlich sind, keine Unfälle und Pannen passieren. Kurz vor der Abfahrt kam dann die Nachricht, dass der Zug ausfällt. Aber es fand sich eine Ersatzverbindung bei der die beiden eine Stunde später losfuhren und eine früher ankamen, in einem besseren Zug. Gott ist gut. Auf der Rückfahrt waren dann alle Züge pünktlich! Wer oft mit der Bahn fährt wird diese Anhäufung an „Zufällen“ doch vielleicht ein Wunder nennen. Ich tue es, weil ich mich lieber zugunsten Gottes irre. Solche Erfahrungen kann man teilen, wenn man anderen begegnet. Und ich wäre gespannt, ob mir Menschen aus anderen Kulturen und Religionen auch solche Erlebnisse schildern könnten. Ich habe es nur selten gehört und daher neige ich dazu zu sagen: Der Christ ist klar im Vorteil.
Deshalb wünsche ich mir, dass jede und jeder Jesus nachfolgt. So gibt es Freiräume, die Welt furchtlos zu verändern und Erfahrungen, die bestätigen, dass Gott mit einem ist. Da bin ich nicht tolerant, sondern liebevoll. Toleranz lässt den anderen stehen (manchmal auch im Regen!). Sie versucht nicht den anderen wirklich zu verstehen, sondern einfach zu akzeptieren. Liebe lässt niemanden (im Regen oder sonst wo im Leben) stehen, sondern will den Anderen verstehen und verändert sehen. Gott ist kein Gott der Toleranz, sondern der Liebe. Gott will nicht nur Vergebung, sondern Veränderung.
Wie ist nun aber mit dem Dialog der Christen untereinander? Haben wir als Methodisten den anderen etwas voraus? Als ich junger Erwachsener und junger Christ mit allerlei schlechten Gewohnheiten zu kämpfen hatte, konnte mich mein lutherischer Pastor nur mit der Zusage der Vergebung trösten. Erst durch die Beschäftigung mit der Theologie Wesleys (der Theologie der verändernden Liebe) lernte ich, dass Veränderung möglich ist. Mein Leben änderte sich radikal. Das Wissen um die Kraft des Heiligen Geistes, Menschen zu verändern, haben wir als Methodisten manch anderen Voraus. Ein Grund, überheblich zu sein? Keinesfalls. Denn zu einem sind solche Erkenntnisse Gnadenakte Gottes. Zum anderen sind uns andere vielleicht in anderen Dingen voraus.
Ich kenne eine Gemeinde, da wird nach jedem Gottesdienst zur „Bekehrung“ aufgerufen. Das anschließende Hingabe-Gebet beten dann alle in der Gemeinde mit. Ich selbst habe auch ein „Bekehrungs-Erlebnis“ gehabt. Mir hilft es, wenn ich mal wieder richtig „Mist gebaut“ habe. So wie mir damals Gott vergeben hat, so auch heute. Ich kann mich so wenig aus dem Glauben herausschleichen, wie ich hineinwachsen konnte. Bin ich nun gegenüber denen im Vorteil, die wie meine Schwiegereltern im Glauben standen, ohne ein Bekehrungsdatum nennen zu können? Auf den ersten Blick meine ich ja, aber mir wird schnell klar: Hier hat Gott meine eigene Geschichte mit mir. Er schenkt mir Erfahrungen, die ich brauche. Diese teile ich mit anderen und wünsche mir sie auch für mein Gegenüber. Aber ich respektiere, dass er Andere anders. Gott ist der Maßstab, nicht meien Erfahrung.
In der Begegnung miteinander lerne ich dann vor allem eins: Gott sieht den Einzelnen. Die Beziehung zu ihm ist individuell geprägt. Das kann auch Mut machen, auf Menschen außerhalb der Gemeinde zuzugehen, weil man weiß, dass Gott ihren Mangel füllen will - denn was ihnen fehlt, ist Jesus, nicht meine eigene Erfahrung mit ihm.
Seiten:Wechsel.
Jetzt bleibt noch die Frage nach der Begegnung mit Menschen anderer Kulturen und Religionen, in Deutschland und weltweit (weswegen ich als Missionssekretär wohl angefragt wurde, etwas zu diesem Thema zu schreiben). Wie kann diese Begegnung zu Gott führen, ohne dass sie rassistisch oder diskriminierend und (ich ergänze kolonialistisch) daherkommt?
Wie schon angeklungen ist, erkenne ich Jesus als Weg, Wahrheit und Leben. Seine Vergebung schenkt mir ewiges Leben, gibt mir Freiräume zum Handeln in verändernder Liebe und wird von Erfahrungen im Alltag bestätigt. Das habe ich manch Anderem voraus. Aber weil es Gnadenerfahrungen sind, lässt mich das nicht überheblich werden. Vielmehr weckt es in mir den Wunsch, dass auch der Andere diese Gnade auf seine ganz eigene Weise erfährt.
In der Weltmission wird das oft aber schon missverstanden. Da ist Mission an sich schon Ausdruck der Überheblichkeit. Soll doch jeder nach seiner Façon selig werden. Mission sei immer auch Kolonialisierung.
Da hilft es sehr, sich zu fragen, was wir denn den Menschen z.B. in Afrika voraushaben. Bildung vielleicht? Medizinische Versorgung? Was wir ihnen voraushaben, sind zweihundert Jahre kolonialistischer Ausbeutung. Europa hat Afrika unterentwickelt, sagt man. Die wunderschönen Häuser der Plantagenbesitzer in den Südstaaten der USA sind von Sklaven gebaut worden. Bis heute ist der Profit, den der globale Norden aus Afrika zieht, höher als die Entwicklungshilfe!
Nach sieben Jahren in Malawi muss ich sagen: Die malawischen Christen haben uns viel voraus. Mit ihren Gebeten tragen sie die Kirche in Europa und den USA. Ein Missionar teilte einmal den Eindruck., dass die Kirche in Europa und den USA nur noch existiere (und nicht wie im Land der Urgemeinden, der heutigen Türkei, nahezu verschwunden ist), sei nur auf die Gebete der afrikanischen Christen zurückzuführen. Sie sind auf Wunder im Alltag angewiesen und beten wie wir es uns nur wünschen können. Sie zögern nicht, andere zum Gottesdienst einzuladen. Nach dem „how are you?“ („wie geht es dir?“) folgt bald ein „where do you worship?“ („wo gehst du zum Gottesdienst?). Dabei geht es nicht darum, jemanden aus einer anderen Gemeinde abzuwerben. Vielmehr sollen die angesprochen werden, die noch nirgendwo Gott(esdienst) feiern, die noch nicht an Jesus glauben. Denn selbst in Malawi mit seinen rund 80 % Christen gibt es solche, die noch völlig unerreicht sind. Nur zwanzig Minuten von großen Straßen entfernt leben Kinder, die in ihrem Leben noch kein Kreuz gesehen haben. Die malawischen Christen überlegen keine Sekunde, ob man diesen Menschen von Jesus erzählen soll. Sie rufen ohne zu zögern nach der Predigt zur Bekehrung auf, sie teilen miteinander ihre Gebetsanliegen und -erhörungen. Kein Wunder ist ihr Glauben stark und ansteckend.
In Malawi hat jetzt eine Dekade der Mobilisierung begonnen. Die Kirchen, die viele Jahre Missionare empfangen haben, wollen zu sendenden Kirchen werden. Wenn dann Missionare aus dem globalen Süden die Kirche in Europa, den USA und Deutschland neu beleben, werden sie viel von aus ihren eigenen Kulturen mitbringen. Wird man ihnen dann auch Rassismus und Diskriminierung vorwerfen? Oder wird ihnen Diskriminierung und Rassismus entgegenschlagen? Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie von der Liebe Gottes getrieben sind, sich von ganzem Herzen Veränderung für Deutschland wünschen und den Menschen hier die gleichen tiefgreifenden Glaubenserfahrungen wünschen, die sie gemacht haben. Unsere Mission besteht nun darin, sie dazu zu bevollmächtigen und auszurüsten. Es ist Zeit für den
Stab:Wechsel!
Verfasser:in Olav Schmidt
Missionssekretär, EmK Weltmission